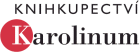NOVINKY:
Altaic Languages
Blažek Václav - Schwarz Michal - Srba Ondřej
Monografie představuje příručku shrnující aktuální stav altajské diachronní lingvistiky. Soustřeďuje se na vývoj poznání turkické, mongolské, tunguzské, korejské a japonské větve, nejprve v perspektivě deskriptivní, posléze komparativní. Zvláštní pozornost je věnována historii dílčích i obecných kla...
Cultural Interactions in the Medieval Subcaucasian Region:
Bacci Michele - Foletti Ivan
Tento dvousvazkový soubor se zaměřuje na materiální a vizuální kulturu jednoho z ústředních území předmoderního světa: jižního Kavkazu, který spojuje Kaspické a Černé moře, východní Evropu a západní Asii. Tento transkontinentální a multikulturní region díky své neobvyklé materiální a vizuální kultuř...
Česká architektura 2022-2023 / Czech Architecture 2022-2023
Nasadil Pavel
Ročenka české architektury pravidelně informuje především laickou zajímající se veřejnost o situaci v oboru a přináší podněty a inspiraci. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr 30 staveb provedl architekt Pavel Nasadil, který také...
Český les - včera a dnes
Procházka Zdeněk
Publikace se tentokrát věnuje těm nejpustějším místům Českého lesa. Prostřednictvím barevných fotografií seznámí čtenáře s tím, co zbylo z nejvýznamnějších obcí sudetských Němců, které musely v 50. letech 20. století ustoupit Železné oponě. Zavede vás na místa, kde stály nebo stojí opuštěné roty PS ...
Hora v moři
Nayler Ray
Lidstvo objevuje inteligentní život v podobě nového druhu chobotnic s vlastním jazykem a kulturou. Nadnárodní technologická korporace Dianima uzavírá odlehlé souostroví Con Dao, kde se objevil dosud neznámý a zřejmě vysoce inteligentní druh chobotnic. Bioložka Ha Nguyenová, která se chováním hlavono...
Jiné texty, jiní autoři
Odehnalová Lenka
V knize se autorský kolektiv zaměřil na proměny žánrů a přístupů k literární tvorbě v současné ruské, běloruské, německé i české literatuře. Lenka Odehnalová sleduje transformaci tradičního žánru (románové kroniky) v současné ruské literatuře na příkladu děl dostupných i v českém překladu (Jákobův ž...
Kolegialita v přípravě učitelů
Juklová Kateřina - Tichotová Sylvie
Společným jmenovatelem této knihy je kolegialita a možnosti její podpory v kontextu pregraduální přípravy učitelů. Autory publikace spojuje nejen téma, ale také zkušenosti z posledních několika let, kdy se jejich profesní cesty spojily v projektu nazvaném "Kolegiální sítě". Záměrem bylo poprvé v aka...
Kontexty 2/2024
kol.
Časopis o kultuře a společnosti. Editorial Stanislav Balík: Příliš drahý experiment Texty Izabella Tabarovsky: Jazyk sovětské propagandy. Pokrokářský antisionismus a jedovaté dědictví studené války Kateřina Hloušková: Ruský Krym? Mýtus, kterému jsme uvěřili Sergej Medveděv: Co čeká Rusko p...
Manuál pro kont(r)akt s rodiči
Misík Michal
"Pokud by ze sebe toxičtí rodiče sňali funkci posuzovatelů -hodnot, ulehčili by sobě, ulehčili by monumentálně svým dětem." Tohle je natolik česká kniha, že víc české už snad ani nic být nemůže! Jak být bohatý. Jak být nad věcí. Jak se dožít vyššího věku. Jak praktikovat jógu. Jak být oblíbený...
Na cestě k Mnichovu
Šebková Jarmila
Co dělal lord Runciman v Československu těsně před tím, než byla Británií a Francií na konci září 1938 s hitlerovským Německem podepsána nechvalně proslulá Mnichovská dohoda, jež definitivně zpečetila osud československé "první republiky"? S jakým cílem jej sem britská vláda vyslala? A co si o tom v...